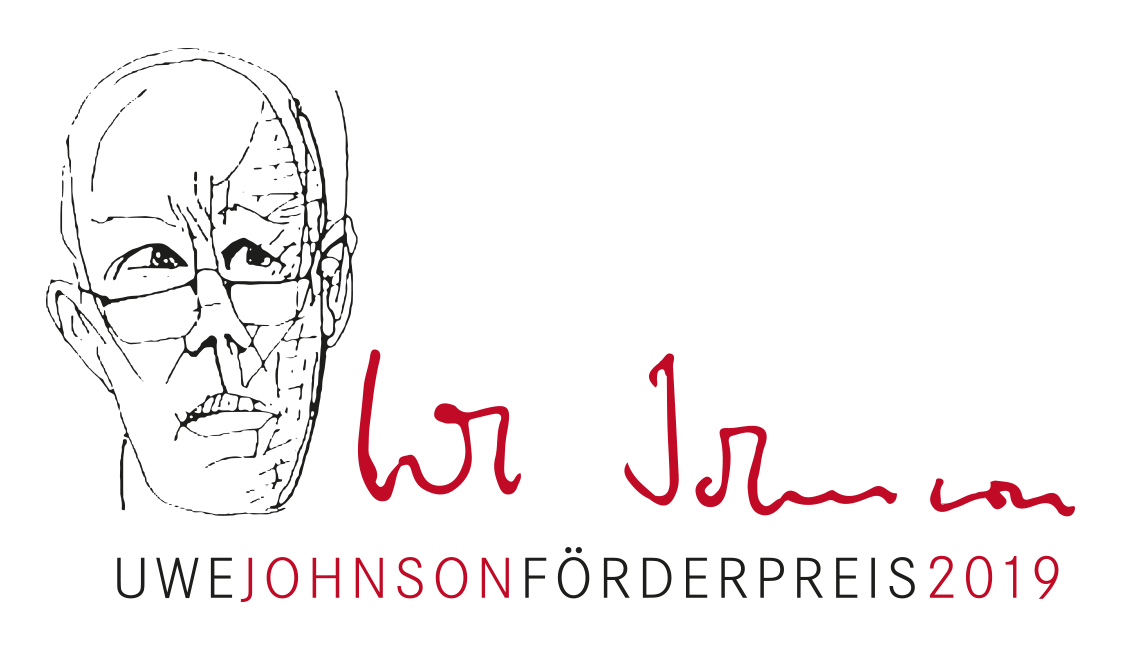Die Begründung der Jury
Judith Zander verbindet in ihrem Roman „Dinge, die wir heute sagten“ auf kunstvolle Weise Vergangenes und Gegenwärtiges. Über das Mit- und Gegeneinander unterschiedlicher Stimmen setzt sich Stück für Stück das Porträt einer vorpommerschen Dorfgemeinschaft zusammen, deren Einzelschicksale über drei Generationen aneinander gebunden sind. Beim Erzählen entsteht ein polyphoner Strom, in dem die unterschiedlichen Figuren jeweils eine aus der subjektiven Erfahrung geronnene unverwechselbare Stimme erhalten.
Wie bei Uwe Johnson zeigt sich, auf welche Weise die Zeitläufte in das Leben des einzelnen eingreifen und was in der Erinnerung von der Geschichte eines Landes bleibt, das es nicht mehr gibt.
Zum Buch
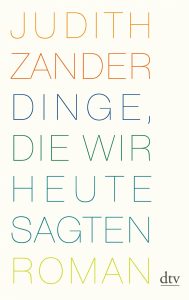 Bresekow, ein Dorf in Vorpommern. Als die alte Frau Hanske stirbt, kommt ihre Tochter Ingrid mit ihrer Familie aus Irland zur Beerdigung. Ingrid hatte Bresekow vor vielen Jahren fluchtartig verlassen. Der Besuch verändert vieles im Dorf, wirft gerade für die Familien Ploetz und Wachlowski alte und neue Fragen auf. Die Dorfbewohner beginnen zu sprechen, über ihr derzeitiges Leben und ihre Verstrickungen von damals. Bresekow war immer eine kleine Welt, eng, abgelegen und heute zudem vom Verfall bedroht.
Bresekow, ein Dorf in Vorpommern. Als die alte Frau Hanske stirbt, kommt ihre Tochter Ingrid mit ihrer Familie aus Irland zur Beerdigung. Ingrid hatte Bresekow vor vielen Jahren fluchtartig verlassen. Der Besuch verändert vieles im Dorf, wirft gerade für die Familien Ploetz und Wachlowski alte und neue Fragen auf. Die Dorfbewohner beginnen zu sprechen, über ihr derzeitiges Leben und ihre Verstrickungen von damals. Bresekow war immer eine kleine Welt, eng, abgelegen und heute zudem vom Verfall bedroht.
Judith Zander lässt drei Generationen zu Wort kommen. Sie erzählt mit ungeheurer Sprachkraft von einem verschwiegenen Ort im Nordosten Deutschlands, von Provinz und Alltag, von Freundschaft und Verrat, vom Leben selbst.
Die Autorin wurde bei den 34. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt für ihren Auszug aus ‚Dinge, die wir heute sagten‘ mit dem 3sat-Preis 2010 geehrt. Sie erhielt für diesen Roman den Preis der Sinecure Landsdorf 2010 und war nominiert für den Klaus-Michael Kühne-Preis 2010. Zudem wurde der Roman auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2010 aufgenommen.
Zur Autorin
Judith Zander wurde 1980 in Anklam geboren. Sie studierte Germanistik, Anglistik und Geschichte in Greifswald, danach am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Die in Berlin lebende Autorin veröffentlichte Lyrik und Prosa in Zeitschriften und Anthologien, war zudem als Übersetzerin aus dem Englischen tätig. 2007 erhielt sie den Lyrikpreis beim 15. Open mike der Literaturwerkstatt Berlin, 2009 den Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis beim Literarischen März.
Für ihren Debütroman wurden ihr der Preis der Sinecure Landsdorf und der 3sat-Preis bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt zuteil; außerdem schaffte es das Buch im vergangenen Herbst auf die Shortlist der sechs besten Neuerscheinungen für den Deutschen Buchpreis, war nominiert für den aspekte-Literaturpreis und den Rauriser Literaturpreis. Im Frühjahr erschien im dtv ihr Gedichtband „oder tau“.
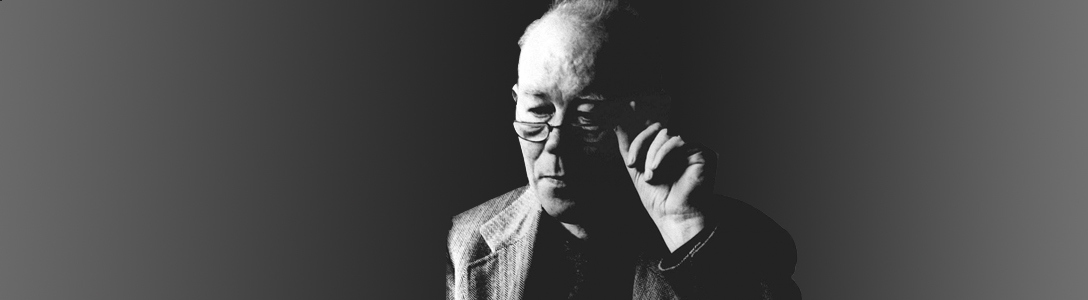


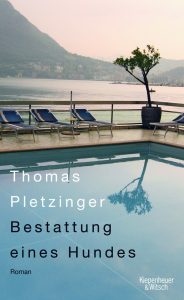 Ein Ethnologe in einer Lebenskrise, ein Kinderbuchautor mit einem Bestseller und einer Ruine am Luganer See, eine finnische Ärztin, ein kleiner Junge ohne Vater, ein mysteriöser Freund, ein sterbender Hund und ein verstecktes Manuskript: Thomas Pletzinger macht daraus eine hochspannende, aberwitzige und anrührende Geschichte.
Ein Ethnologe in einer Lebenskrise, ein Kinderbuchautor mit einem Bestseller und einer Ruine am Luganer See, eine finnische Ärztin, ein kleiner Junge ohne Vater, ein mysteriöser Freund, ein sterbender Hund und ein verstecktes Manuskript: Thomas Pletzinger macht daraus eine hochspannende, aberwitzige und anrührende Geschichte.
 Eduard, der Mathematiker und Zeitpedant, liebt Anna, die Sängerin. Und zum Glück liebt Anna auch Eduard. Es geschah einfach so, eines Tages in einer Erfurter Konsum-Filiale, der Anna als Leiterin vorsteht. Den lieben langen Tag singt sie in ihrem Filialleiterbüro und hat mit ihrer Stimme nicht nur Eduard sirenengleich angelockt. Paul Händl, Eduards Freund aus Kindertagen, geht es hingegen nicht um die Kunst, sondern um die verlorene Heimat, ums Egerland, aus dem sie alle nach Kriegsende vertrieben wurden: Eduard und seine Mutter Ella, Paul und sein wetterwendischer Vater, die Regalsteher im Braumann’schen Laden und Exgeheimrat Emil Gumpl. Hier in Erfurt ringen sie seither mit ihren Erinnerungen wie die Dämmerung mit der Nacht. 1969, am Tag des Eishockeyspiels UdSSR gegen CðSSR, bricht Paul zu einer Kundgebung für die Rechte der Sudetendeutschen nach Prag auf. Auch Eduard landet, ganz gegen seine Absicht, zur selben Zeit in der tschechoslowakischen Hauptstadt, und von da an lungert einmal nicht die Erinnerung in ihren Köpfen herum, sondern schlägt die sozialistische Gegenwart zu. Bis Eduard sein Gedächtnis verliert, die Erfurter Domuhr explodiert und ein Stück deutsche Geschichte vor dem Vergessen bewahrt wird.
Eduard, der Mathematiker und Zeitpedant, liebt Anna, die Sängerin. Und zum Glück liebt Anna auch Eduard. Es geschah einfach so, eines Tages in einer Erfurter Konsum-Filiale, der Anna als Leiterin vorsteht. Den lieben langen Tag singt sie in ihrem Filialleiterbüro und hat mit ihrer Stimme nicht nur Eduard sirenengleich angelockt. Paul Händl, Eduards Freund aus Kindertagen, geht es hingegen nicht um die Kunst, sondern um die verlorene Heimat, ums Egerland, aus dem sie alle nach Kriegsende vertrieben wurden: Eduard und seine Mutter Ella, Paul und sein wetterwendischer Vater, die Regalsteher im Braumann’schen Laden und Exgeheimrat Emil Gumpl. Hier in Erfurt ringen sie seither mit ihren Erinnerungen wie die Dämmerung mit der Nacht. 1969, am Tag des Eishockeyspiels UdSSR gegen CðSSR, bricht Paul zu einer Kundgebung für die Rechte der Sudetendeutschen nach Prag auf. Auch Eduard landet, ganz gegen seine Absicht, zur selben Zeit in der tschechoslowakischen Hauptstadt, und von da an lungert einmal nicht die Erinnerung in ihren Köpfen herum, sondern schlägt die sozialistische Gegenwart zu. Bis Eduard sein Gedächtnis verliert, die Erfurter Domuhr explodiert und ein Stück deutsche Geschichte vor dem Vergessen bewahrt wird.
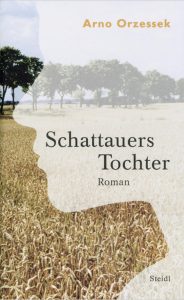 Die achtzehnjährige Marie Schattauer, das bezaubernde, scheinbar naive Kind masurischer Gebetsleute, verliebt sich, zwischen Geboten und Gelüsten hin- und hergerissen, im August 1937 in den lebenslustigen Leutnant Hermann Eckstein und folgt ihm gegen den Willen der Eltern nach Westen. Es ist ein Aufbruch in glückliche, in finstere Zeiten – in die Liebe und den Krieg.
Die achtzehnjährige Marie Schattauer, das bezaubernde, scheinbar naive Kind masurischer Gebetsleute, verliebt sich, zwischen Geboten und Gelüsten hin- und hergerissen, im August 1937 in den lebenslustigen Leutnant Hermann Eckstein und folgt ihm gegen den Willen der Eltern nach Westen. Es ist ein Aufbruch in glückliche, in finstere Zeiten – in die Liebe und den Krieg.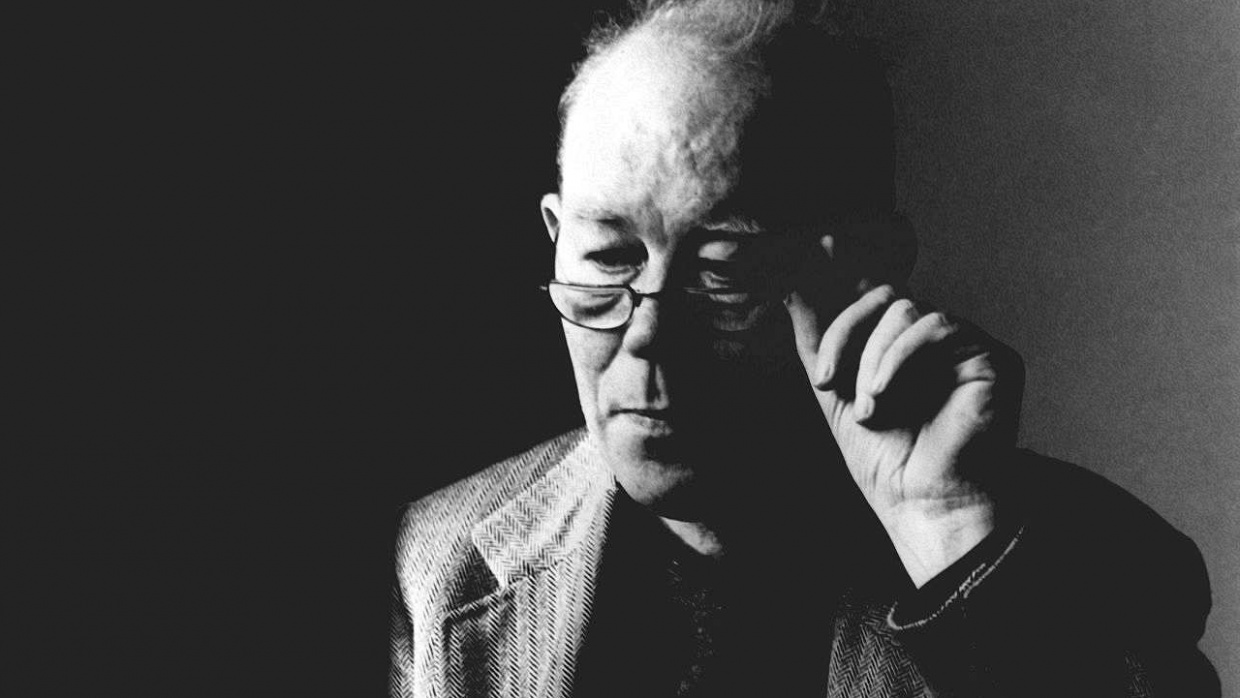

 Markus Frank (geboren 1965 in Bremen) ist Rechtsanwalt bei Gentz und Partner. Markus Frank lebt in Berlin und ist seit 2012 Mitglied im Kuratorium des Uwe-Johnson-Preises.
Markus Frank (geboren 1965 in Bremen) ist Rechtsanwalt bei Gentz und Partner. Markus Frank lebt in Berlin und ist seit 2012 Mitglied im Kuratorium des Uwe-Johnson-Preises.


 Michael Hametner (geboren 1950 in Rostock) studierte Journalistik, Literaturwissenschaft und Germanistik in Leipzig. Hametner arbeitet als Kritiker für Hörspiel und Theater und war von 1994 bis 2015 bei MDR Figaro leitender Literaturredakteur und Moderator. Er begründete den MDR-Literaturwettbewerb und war u. a. Mitglied in der Jury für den Leipziger Buchpreis 2007 bis 2009. Er ist außerdem als Autor und Herausgeber aktiv und seit 2007 Mitglied der Jury für den Uwe-Johnson-Preis und für den Uwe-Johnson-Förderpreis. Hametner lebt in Leipzig.
Michael Hametner (geboren 1950 in Rostock) studierte Journalistik, Literaturwissenschaft und Germanistik in Leipzig. Hametner arbeitet als Kritiker für Hörspiel und Theater und war von 1994 bis 2015 bei MDR Figaro leitender Literaturredakteur und Moderator. Er begründete den MDR-Literaturwettbewerb und war u. a. Mitglied in der Jury für den Leipziger Buchpreis 2007 bis 2009. Er ist außerdem als Autor und Herausgeber aktiv und seit 2007 Mitglied der Jury für den Uwe-Johnson-Preis und für den Uwe-Johnson-Förderpreis. Hametner lebt in Leipzig.
 René Strien (geboren 1953 in Solingen) studierte zunächst Rechtswissenschaften, später dann Germanistik und Romanistik an der Universität zu Köln. Nach einer Karriere als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent am Romanistischen Seminar der Universität zu Köln, war er 1989 bis 1993 als Lektor beim Gustav Lübbe Verlag (Bergisch Gladbach) tätig. 1994 wurde er Verlagsleiter des Aufbau Verlages Berlin; von 1995 bis 2014 war er Geschäftsführer des Verlages. Er ist Mitglied der Jury für den Uwe-Johnson-Preis und den Förderpreis.
René Strien (geboren 1953 in Solingen) studierte zunächst Rechtswissenschaften, später dann Germanistik und Romanistik an der Universität zu Köln. Nach einer Karriere als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent am Romanistischen Seminar der Universität zu Köln, war er 1989 bis 1993 als Lektor beim Gustav Lübbe Verlag (Bergisch Gladbach) tätig. 1994 wurde er Verlagsleiter des Aufbau Verlages Berlin; von 1995 bis 2014 war er Geschäftsführer des Verlages. Er ist Mitglied der Jury für den Uwe-Johnson-Preis und den Förderpreis.