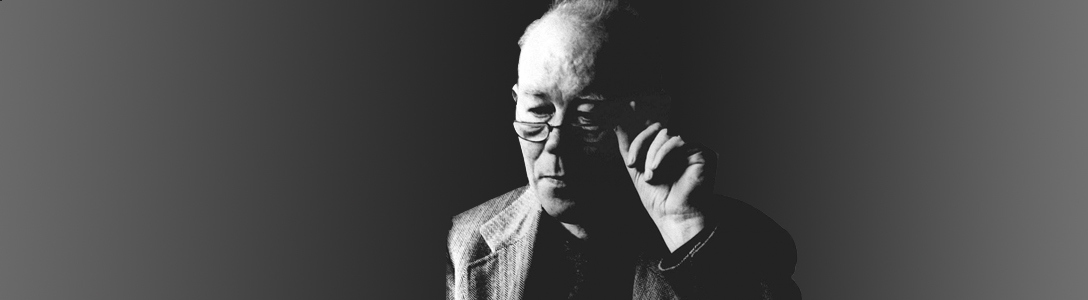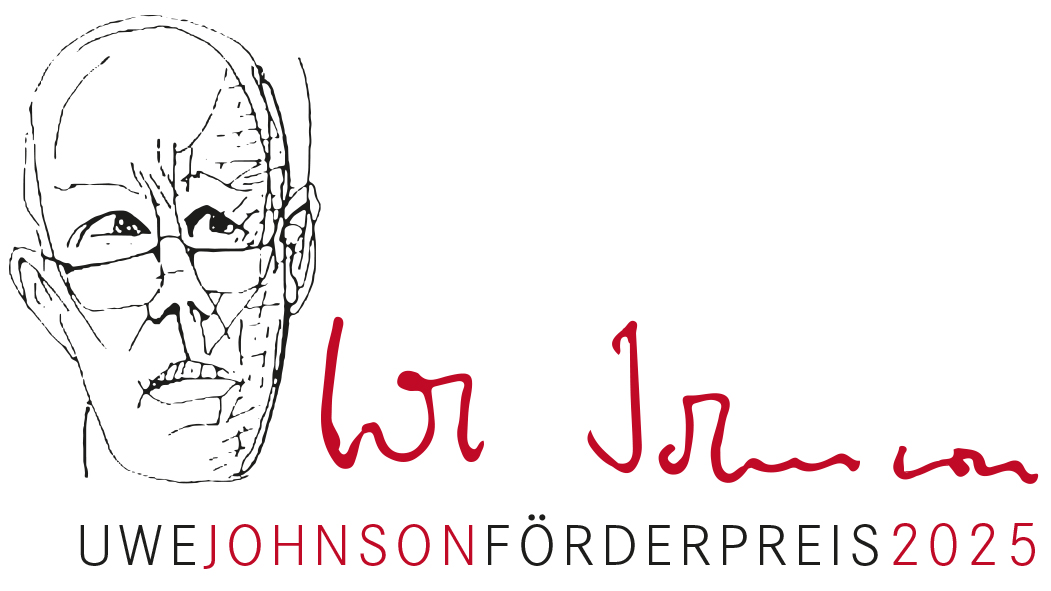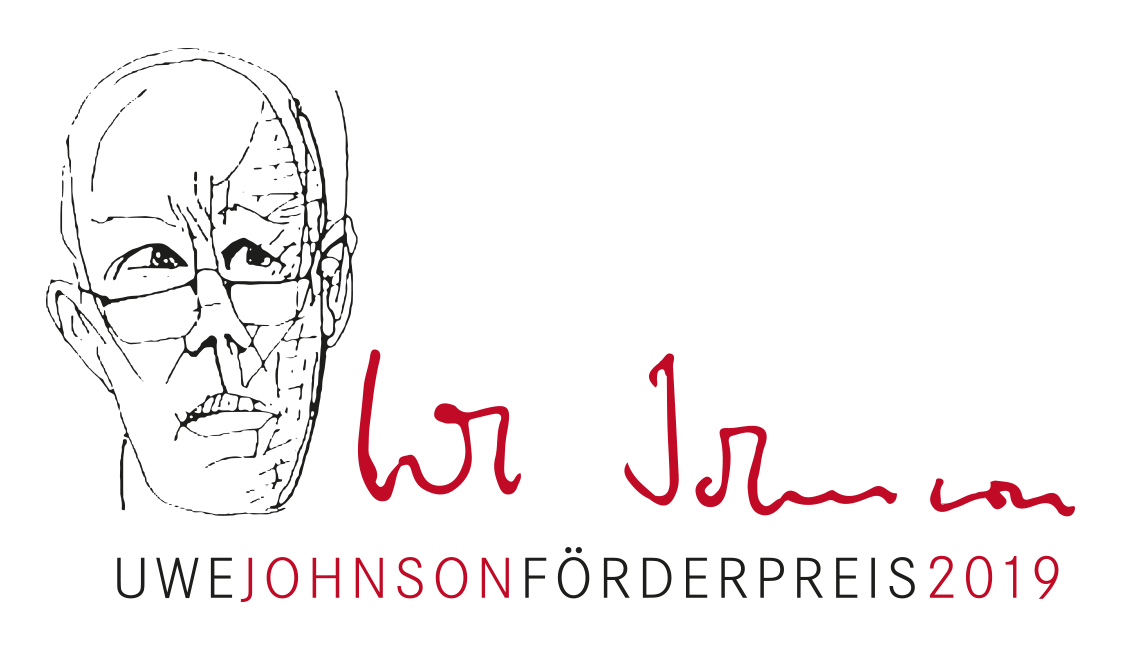Die UWE JOHNSON-TAGE 2025 finden vom 22. September bis zum 14. November statt.
Wir laden Sie herzlich ein zur Veranstaltungsreihe der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft e.V. und der Barlachstadt Güstrow gemeinsam mit dem Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg KdöR und der Gentz Rechtsanwälte und Notare.
PROGRAMM (hier als PDF abrufbar)
Montag, 22. September 2025
Regionalbibliothek
Marktplatz 1 | 17033 Neubrandenburg
19.00 Uhr
Eröffnung der Uwe Johnson Tage 2025
durch PROF. DR. CARSTEN GANSEL,
Mecklenburgische Literaturgesellschaft e.V.,
und DR. TILMANN WESOLOWSKI,
Uwe Johnson-Bibliothek Güstrow
„Lichtungen“ – Lesung und Gespräch mit IRIS WOLFF
Uwe Johnson-Preisträgerin 2024
Moderation: CARSTEN GANSEL
—
Dienstag, 23. September 2025
Uwe Johnson-Bibliothek Güstrow
Am Wall 2 | 18273 Güstrow
19.30 Uhr
„Lichtungen“ – Lesung und Gespräch mit IRIS WOLFF, Uwe Johnson-Preisträgerin 2024
Moderation: TILMANN WESOLOWSKI
Iris Wolffs Roman „Lichtungen“ setzt vergleichbar ein wie Uwe Johnsons „Mutmassungen über Jakob“ (1959), nämlich mit dem Ende. Die Hauptfiguren Lev und Kato finden sich nach vielen Jahren wieder. Nun wird von der Kindheit und Jugend der Protagonisten im sozialistischen Rumänien erzählt. Es ist dies – wie bei Johnson – eine Spurensuche, in der es darum geht, erzählend, „eine Wirklichkeit, die vergangen ist, wiederherzustellen“. Dabei wird offenbar, auf welche Weise die Zeitläufte in das Leben des einzelnen eingreifen und es zu Brüchen in der Biographie gekommen ist. Es geht um Menschen, denen eine Nationalität staatlich zugeschrieben wird, die sich aber eher Landschaften, Sprachen, Bildern zugehörig fühlen. „Lichtungen“ ist auch ein Roman, der dem literarisch nachfragt, was Heimat sein kann oder ist. (Aus der Jurybegründung)
—
Donnerstag, 25. September 2025
Uwe Johnson-Bibliothek Güstrow
Am Wall 2 | 18273 Güstrow
19.30 Uhr
„Das Wohlbefinden“ – Lesung und Gespräch mit ULLA LENZE
Moderation: TILMANN WESOLOWSKI
Ulla Lenzes ambitionierter Roman über drei sehr verschiedene Frauenfiguren spielt in der Lungenheilstätte Beelitz, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor den Toren Berlins für die Arbeiterklasse errichtet wurde. Die Arbeiterin Anna Brenner besitzt anscheinend die Gabe der Hellsichtigkeit und schart eine immer größer werdende Anhängerschaft um sich. Auch die Schriftstellerin Johanna Schellmann wird auf sie aufmerksam und es beginnt eine letztlich unglückselige Verbindung der beiden Frauen … Die Instrumentalisierung des Übersinnlichen wird mit Familiengeschichte und weiblicher Emanzipation zu einem Stückchen literarisch aufgearbeiteter Kulturgeschichte verwoben.
Ulla Lenze, 1973 in Mönchengladbach geboren, studierte Musik und Philosophie in Köln. Für ihre Romane wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Ihr Roman „Der Empfänger“ (2020) wurde in elf Sprachen übersetzt. Im Frühjahr 2023 hatte sie die renommierte Max-Kade-Gastprofessur am Dartmouth College (USA) inne. Ulla Lenze lebt in Buckow in der Nähe von Berlin.
—
Freitag, 26. September 2025
Schauspielhaus | Probebühne
Pfaffenstraße 22 | 17033 Neubrandenburg
19.00 Uhr
Verleihung des Uwe Johnson-Förderpreises 2025
an KURT TALLERT für „Spur und Abweg“
Grußwort: NICO KLOSE, Oberbürgermeister
Laudatio: DR. ANNETTE LEO, Historikerin und Publizistin
Lesung und Gespräch mit dem Preisträger
Moderation: MICHAEL HAMETNER
—
Donnerstag, 2. Oktober 2025
Stadtarchiv
Marktplatz 1 (Eingang Darrenstraße) | 17033 Neubrandenburg
19.00 Uhr
„Aus dem (verschwiegenen) Innenleben der DDR“ – ARAM RADOMSKIS Filme und der Weg zur Wende
Moderation: CARSTEN GANSEL
Die bedeutende Großdemonstration am 9. Oktober 1989 in Leipzig war so etwas wie eine Initialzündung für den Herbst 1989 und die Wende. Eine breite Öffentlichkeit erfuhr von dieser Demonstration, an der nach ersten Schätzungen 70.000 Menschen teilnahmen, durch die Filmaufnahmen von Aram Radomski und Siegbert Schefke, die in die weltweite Kommunikation eingespeist wurden.
Aram Radomski, in Neubrandenburg aufgewachsen und als Sohn von Gert Neumann und Enkelsohn von Margarete Neumann schon früh mit Literatur und Kunst in Berührung gekommen, hatte ab 1986 undercover u.a. für die ARD-Sendung „Kontraste“ Filmaufnahmen aus dem Inneren der DDR gemacht.
Im Rahmen der Uwe Johnson-Tage wird er einige der Ansichten vorstellen. Dabei geht es u.a. um spektakuläre Aufnahmen vom Verfall der Städte, die auf einer Tour von Anklam über Greifswald nach Rostock entstanden. „Biographie ist unwiderruflich“, dieser Satz von Uwe Johnson wird im Gespräch vertieft werden.
—
Dienstag, 7. Oktober 2025
Frau Rilke Buchladen
Strelitzer Straße 11 | 17235 Neustrelitz
19.00 Uhr
„Schwebende Lasten“ – Lesung und Gespräch mit ANNETT GRÖSCHNER
Moderation: KATHRIN MATERN
Nicht weniger als ein ganzes Leben erzählt Annett Gröschner mit der Geschichte der Blumenbinderin und Kranfahrerin Hanna Krause aus Magdeburg – mit einer Wucht und Poesie, wie sie nur dort entstehen können, wo die Literatur wirklichkeitssatt ist. Hanna Krause war Blumenbinderin, bevor das Leben sie zur Kranführerin machte. Sie hat zwei Revolutionen, zwei Diktaturen, einen Aufstand, zwei Weltkriege und zwei Niederlagen, zwei Demokratien, den Kaiser und andere Führer, gute und schlechte Zeiten erlebt, hat sechs Kinder geboren und zwei davon nicht begraben können, was ihr naheging bis zum Lebensende.
Annett Gröschner, geboren 1964 in Magdeburg, lebt seit 1983 als Schriftstellerin in Berlin. Bekannt wurde sie vor allem mit ihren Romanen „Moskauer Eis“ (2000) und „Walpurgistag“ (2011). Zuletzt erschien ihr gemeinsam mit Peggy Mädler und Wenke Seemann verfasster Bestseller „Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat“ (2024). Annett Gröschner wurde vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Literaturpreis von ZDF, 3sat und der Landeshauptstadt Mainz.
—
Mittwoch, 8. Oktober 2025
Kunstsammlung Neubrandenburg
Große Wollweberstraße 24 | 17033 Neubrandenburg
19.00 Uhr
„Der heutige Tag. Ein Stundenbuch der Liebe“ – Lesung und Gespräch mit HELGA SCHUBERT
Moderation: CARSTEN GANSEL
„Vielleicht ist einer von uns morgen schon nicht mehr da.“ Über fünfzig Jahre lang teilen sie ihr Leben. Doch nun ist der Mann schwer krank. Lange schon palliativ umsorgt, wird sein Radius immer eingeschränkter, der Besuch weniger, die Abhängigkeiten größer. Entlang der Stunden eines Tages erzählt Helga Schubert davon, wie man in solchen Umständen selbst den Verstand und der andere die Würde behält, wie es ist, mit einem todkranken Menschen durch dessen Zwischenwelten zu wandeln. Und davon, wie Liebe zu Erbarmen wird. Eine Liebeserklärung an den Mann an ihrer Seite und all die Dinge, die das Leben inmitten der Widrigkeiten des Alters lebenswert machen.
Helga Schubert, geboren 1940 in Berlin, war Psychotherapeutin und Schriftstellerin in der DDR. Sie zog sich aus der literarischen Öffentlichkeit zurück, bis sie 2020 mit der Geschichte „Vom Aufstehen“ den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. Der gleichnamige Erzählband erschien 2021 und war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. 2024 wurde Helga Schubert mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Landeskulturpreis MV ausgezeichnet.
—-
Donnerstag, 9. Oktober 2025
Kulturquartier
Schloßstraße 12/13 | 17235 Neustrelitz
19.00 Uhr
„Meine Fensterplätze“ – Lesung und Gespräch mit GITTA LINDEMANN
Moderation: CARSTEN GANSEL
Gitta Lindemann hat schon immer geschrieben, aber fast alle Ergebnisse haben dem eigenen kritischen Blick nicht standgehalten. Erst mit den 1990er Jahren und den damit in Verbindung stehenden Veränderungen hat sie frühere Ansätze aufgegriffen. Entstanden sind berührende Geschichten, in denen das Erinnern eine zentrale Rolle spielt. Eingeschrieben ist den Texten Uwe Johnsons Frage „was war eigentlich bis jetzt: Woher komme ich, und was hat mich zu dem gemacht, was ich bin“.
Gitta Lindemann wurde 1939 in Dresden geboren. Von 1957 bis 1962 studierte sie Journalistik in Leipzig. Von 1969 bis 1974 arbeitete sie im Studio Neubrandenburg von Radio DDR, von 1974 bis 1989 bei der Ferienwelle in Rostock. 1990 wurde sie Chefredakteurin von Radio Mecklenburg Vorpommern, 1992 Kulturchefin bei NDR 1 Radio MV in Schwerin, dort erfand und leitete sie die Reihe „Kunstkaten“ und war Mitbegründerin des NDR-Literaturcafés. Gitta Lindemann lebt und arbeitet in Wendisch-Rambow.
—
Donnerstag, 23. Oktober 2025
Regionalbibliothek
Marktplatz 1 | 17033 Neubrandenburg
19.00 Uhr
„Die vorletzte Frau“ – Lesung und Gespräch mit KATJA OSKAMP
Moderation: MATTHIAS WOLF
Sie lernt ihn kennen, als sie noch jung ist und er beinahe schon alt. Er, der berühmte Schriftsteller. Sie, die mit dem Schreiben gerade anfängt und Mutter einer kleinen Tochter ist. Sie wird seine Schülerin, seine Geliebte, seine Vertraute, und beide schwören, sich einander zuzumuten „mit allen Meisen und Absonderlichkeiten“. 19 Jahre lang waren „Tosch“ und die „Erzählerin Oskamp“ ein Paar. Die Schriftstellerin Katja Oskamp erzählt ihre eigene Geschichte. Es ist ein Roman über Bleiben und Gehen, über Ost und West, über Oben und Unten, darüber, wie die Liebe kommt und wie sie vergeht.
Katja Oskamp, geboren 1970 in Leipzig, ist in Berlin aufgewachsen. Nach dem Studium der Theaterwissenschaft arbeitete sie als Dramaturgin am Volkstheater Rostock und studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. 2019 erschien ihr verfilmter Bestseller „Marzahn, mon amour“, für dessen englische Ausgabe sie 2023 zusammen mit der Übersetzerin den Dublin Literary Award erhielt.
—
Montag, 27. Oktober 2025
Kunstsammlung
Große Wollweberstraße 24 | 17033 Neubrandenburg
19.00 Uhr
„Zärtlicher Regen, Erinnerung – Die Dichterin Eva Strittmatter“ – Film und Gespräch mit LEONORE BRANDT
Moderation: CARSTEN GANSEL
Eva Strittmatter (1930-2011) war die erfolgreichste Lyrikerin der DDR. Ihre Gedichtbände konnten in mehreren Hunderttausend Exemplaren verkauft werden, ohne den tatsächlichen Bedarf ganz sättigen zu können. Zeitweilig überstrahlte ihr Ruhm sogar den ihres Mannes, des Schriftstellers Erwin Strittmatter. Vielen Menschen im Osten boten ihre Gedichte Trost und Hoffnung in der „zementierten“ Zeit des DDR-Sozialismus. Leonore Brandt porträtierte Eva Strittmatter 1995 für die MDR-Reihe „Lebensläufe“.
Leonore Brandt wurde 1953 in Halle-Saale geboren. Sie ist Autorin und Regisseurin, bekannt für die Filmreihe „Die Geschichte Mitteldeutschlands“ und ihre sensiblen Filmporträts von Künstlern.
—-
Donnerstag, 30. Oktober 2025
Stadtarchiv
Marktplatz 1 (Eingang Darrenstraße) | 17033 Neubrandenburg
19.00 Uhr
„Wie Grischa mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste“ – Lesung und Gespräch
mit JAKOB HEIN
Moderation: MATTHIAS WOLF
Nicht im Traum wäre sein Chef darauf gekommen, dass ausgerechnet Grischa, dieser schüchterne Assistent der Staatlichen Plankommission, zu Subversion neigt und einen – zugegeben – ziemlich genialen Plan ausheckt, wie ihr maroder Laden an eine neue, überraschend gut sprudelnde Finanzquelle gelangt. Wobei ‚Laden‘ in diesem Fall für ein ganzes Land steht.
Am Grenzübergang Invalidenstraße spielen sich im Kaufrausch sodann tumultartige Szenen ab, und zwar auf der falschen (!) Seite. Hunderte junge Leute wollen nach drüben, in den Osten, als wäre Magie im Spiel. Als die Regierung in Bonn Wind davon bekommt, wird die Lage brenzlig. Doch da macht der Osten dem Westen ein Angebot, das er nicht ablehnen kann!
Jakob Hein, geboren 1971 in Leipzig, ist Schriftsteller und Arzt. Er arbeitet als Psychiater und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Sein Band „Hypochonder leben länger und andere gute Nachrichten aus meiner psychiatrischen Praxis“ (2020) stand wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.
—
Donnerstag, 6. November 2025
Stadtarchiv
Marktplatz 1 (Eingang Darrenstraße) | 17033 Neubrandenburg
19.00 Uhr
„Medienskepsis in Ostdeutschland. Warum das Misstrauen in den Journalismus kein Erbe der DDR ist“ – Lesung und Gespräch mit MICHAEL MEYEN
Moderation: CARSTEN GANSEL
Warum ist die Medienskepsis im Osten der Bundesrepublik größer als im Westen? Haben wir es hier tatsächlich mit einem Erbe der DDR zu tun, wie oft behauptet wird, oder gibt es für die Kritik am Journalismus und die Wahlerfolge der AfD andere Ursachen? Das neue Buch von Michael Meyen zeigt, dass DDR-Erfahrungen auch dann nicht automatisch Zweifel am Journalismus der Gegenwart nach sich ziehen, wenn sie in der Familie weitergegeben wurden. Medienkritik und Wahlergebnisse in Ostdeutschland sind kein Erbe der Vergangenheit, sondern wurzeln in Brüchen zwischen Ideologie, Leitmedien und Wirklichkeit, die auch im Westen zu beobachten sind.
Michael Meyen, 1967 auf Rügen geboren und in der DDR auf dem Weg, Journalist zu werden, ist seit 2002 Professor für Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
—
Dienstag, 11. November 2025
Regionalbibliothek
Marktplatz 1 | 17033 Neubrandenburg
19.00 Uhr
„Angela Merkel. Zwischen Legende und Wirklichkeit – Die kritische Biografie“ – Lesung und Gespräch mit KLAUS-RÜDIGER MAI
Moderation: CARSTEN GANSEL
Nach Angela Merkels Ausstieg aus der Politik wurden ihre Fehler unter großem Propagandaaufwand in Heldentaten umgemünzt – Klaus-Rüdiger Mai setzt in seiner kritischen Biografie der Ex-Kanzlerin Fakten gegen Legenden und widmet sich der Frage: Warum handelte Angela Merkel, wie sie handelte? Dabei geht es ihm um eine kühle und glasklare historische Analyse. Vor allem aber geht es um die große Leidenschaft der Angela Merkel: ihre Liebe zur Macht und darum, diese zu durchschauen und zu entzaubern.
Klaus-Rüdiger Mai, geboren 1963 in Staßfurt, ist Germanist, Historiker und Philosoph. Sein Spezialgebiet sind die künstlerischen, philosophischen und wirtschaftlichen Kulturen Europas gestern und heute sowie die Geschichte und Gegenwart Ostdeutschlands und Osteuropas. Er ist erfolgreicher Roman- und Sachbuchautor, Essayist und Publizist und lebt mit seiner Familie bei Berlin
—
Donnerstag, 13. November 2025
Schauspielhaus
Pfaffenstraße 22 | 17033 Neubrandenburg
19.30 Uhr
„Wenn du wüsstest, was ich weiß… Uwe Johnson – der Autor meines Lebens“
Ein Abend mit CHARLY HÜBNER
Moderation: MATTHIAS WOLF
Die Mauer ist gerade erst gefallen. Im mecklenburgischen Neustrelitz verlässt der 19-jährige Charly Hübner sein Elternhaus im Streit. Er findet Zuflucht am Theater und in der Literatur, liest wie besessen und landet nahezu unumgänglich bei den „Jahrestagen“ von Uwe Johnson. Er taucht darin ein – und sehr lange nicht wieder auf. Aus dem Teenager von damals ist einer der beliebtesten Schauspieler des mehr oder weniger vereinten Deutschland geworden. Charly Hübners Lektüre des Weltautors Johnson, eines genauen Beobachters seiner Zeit, der wie kein anderer die Sprache und Denkweise der Menschen um ihn herum zu Papier gebracht hat, ist heute aktueller denn je.
Charly Hübner, geboren 1972 in Neustrelitz, ist Schauspieler, Regisseur sowie Sprecher von Hörspielen und Hörbüchern. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Bayerische Fernsehpreis, der Grimme-Preis, der Deutsche Fernsehpreis sowie der Deutsche Hörbuchpreis. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg.
In Zusammenarbeit mit der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz
—
Freitag, 14. November 2025
Uwe Johnson-Bibliothek Güstrow
Am Wall 2 | 18273 Güstrow
19.30 Uhr
„Blitz aus heiterm Himmel“ – Erzählungen von Christa Wolf, Sarah Kirsch, Günter de Bruyn u.a., herausgegeben von EDITH ANDERSON – Lesung und Gespräch mit CARSTEN GANSEL
Moderation: TILMANN WESOLOWSKI
„Man wacht eines Morgens auf und findet sein Geschlecht vertauscht.“ Edith Andersons Idee, Anfang der 1970er Jahre Autorinnen und Autoren zu Geschichten über Geschlechtertausch anzuregen, hatte ihren Ausgangspunkt in der „Ungerechtigkeit, über die eine Frau jeden Tag ihres Lebens stolpert“ – auch in der DDR, die sich die Emanzipation auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Die Funktionäre waren alarmiert: Sie sabotierten das Projekt. Die Anthologie konnte nach einem fünf Jahre währenden Aufbegehren aller Beteiligten, erst 1975 erscheinen. Sie demonstriert eindrücklich die einzigartige, der Literatur innewohnende Kraft, wenn es darum geht, Zukunftsvisionen zu entwerfen.
Carsten Gansels Essay zur wechselvollen Entstehungsgeschichte der Anthologie soll Ausgangspunkt für diese Wiederentdeckung sein.
—
Die Mecklenburgische Literaturgesellschaft und die Barlachstadt Güstrow danken dem Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten Mecklenburg-Vorpommern,
dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, der Stadt Neubrandenburg, dem Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg KdöR und Gentz und Partner Rechtsanwälte mbB sowie der Stiftung der Neubrandenburger Sparkasse für die Förderung der Uwe Johnson-Tage 2025.
PROF. DR. CARSTEN GANSEL
Vorsitzender
Mecklenburgische Literaturgesellschaft e.V.
SASCHA ZIMMERMANN
Bürgermeister der Barlachstadt Güstrow
MARKUS FRANK
Gentz Rechtsanwälte und Notare
KATRIN RACZYNSKI
Vorstand des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg KdöR
Vorbestellung / Information:
Mecklenburgische Literaturgesellschaft e.V.
MATTHIAS WOLF
2. Ringstraße | Wiekhaus 21 | 17033 Neubrandenburg
Telefon: 0395 544 16 71
E-Mail: pegasus-mlg@gmx.de
www.mlg.de
Uwe Johnson-Bibliothek Barlachstadt Güstrow
DR. TILMANN WESOLOWSKI
Am Wall 2 | 18273 Güstrow
Telefon: 03843 76 94 65
E-Mail: uwe-johnson-bibliothek@guestrow.de
www.uwe-johnson-bibliothek.de
Frau Rilke Buchladen
KATHRIN MATERN
Strelitzer Straße 11 | 17235 Neustrelitz
Telefon: 03981 205063
E-Mail: buchladen@frau-rilke.de
www.frau-rilke.de
Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz
DOROTHEA KLEIN-ONNEN
Schloßstraße 12/13
17235 Neustrelitz
Telefon: 03981 23909-99
E-Mail:info@kulturquartier-neustrelitz
www.kulturquartier-neustrelitz.de
Tickets für die Veranstaltung am 13.11.2025 im Schauspielhaus Neubrandenburg: Ein Abend mit CHARLY HÜBNER gibt es ausschließlich bei der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz:
Theater-Service Neustrelitz
Strelitzer Straße 38 |17235 Neustrelitz
Telefon: 03981 20 64 00
E-Mail: serviceNZ@tog.de
Besucher-Service Neubrandenburg im SCHAUSPIELHAUS
Pfaffenstraße 18-22 | 17033 Neubrandenburg
Telefon: 0395 569 98 32
E-Mail: serviceNB@tog.de
www.tog.de
www.uwejohnsonpreis.de