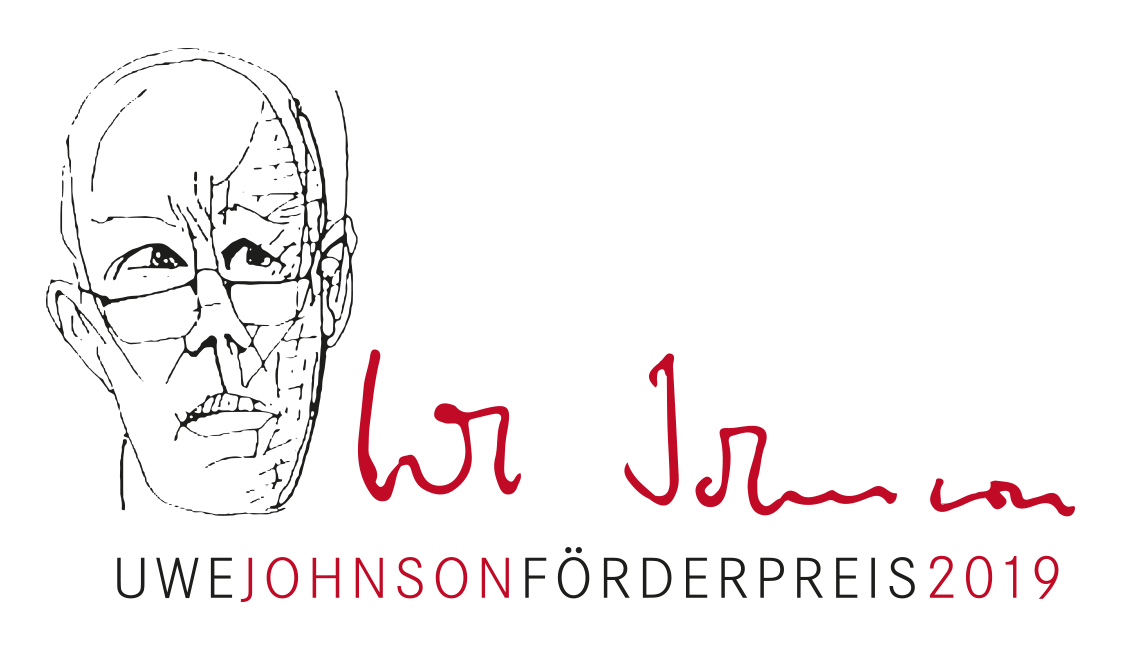Die Begründung der Jury
Jan Koneffke entwirft in seinem Roman „Ein Sonntagskind“ ein deutsches Panorama, das vom Zweiten Weltkrieg über das Jahr 1989 bis in die Gegenwart führt. Der „Versuch, einen Vater zu finden“ (Uwe Johnson) führt den Erzähler zur Näherung an eine bislang unbekannte Lebensgeschichte.
Eng an die Perspektive der Vaterfigur gebunden, wird der Leser mit einem Geflecht von Schuld, Verdrängung, Selbstbetrug und Schweigen konfrontiert. Der Fund von Briefen des damals jungen Wehrmachtssoldaten stört den recherchierenden Sohn in hohem Maße auf und lässt die Figur des Vaters in einem anderen Licht erscheinen.
Wie bei Uwe Johnson wird offenkundig, auf welche Weise der Einzelne im 20. Jahrhundert in die gesellschaftlichen Zeitläufte hineingezogen wurde und es zu Brüchen in der Biographie gekommen ist. So zeigt Jan Koneffke, wie erschreckend widerstandslos sich der spätere linksliberale Philosophieprofessor als Landser im Zweiten Weltkrieg eingeordnet hat und zum Handlanger eines unmenschlichen Systems wurde. Dennoch wird – wie bei Uwe Johnson – die kathartische Entdeckung von Schuld und Verstrickung nicht zur Projektionsfläche für moralische Aburteilung durch die Nachgeborenen, sondern zum Ausgangspunkt für (selbst)kritische Fragen nach dem Vergangenen, Gegenwärtigen und Zukünftigen.
Jan Koneffke zieht mit seiner Romantrilogie einen faszinierenden Bogen, der mit der Vertreibung aus Pommern einsetzt („Eine nie vergessene Geschichte“), über den Zweiten Weltkrieg von Berlin nach Bukarest führt („Die sieben Leben des Felix Kannmacher“) und mit „Ein Sonntagskind“ in einer historischen Gegenwart ankommt.
Zum Buch
Winter 1944/45: Um seinen unreifen Sohn Konrad vor den Werbern der SS zu retten, drängt dessen Nazi-skeptischer Vater ihn, freiwillig Reserveoffizier bei der Wehrmacht zu werden; kurz darauf rät er ihm sogar zur Fahnenflucht – Hitlerjunge Konrad graut es zwar vor Kampfeinsätzen, zugleich ist er aber über den mangelnden Patriotismus des Vaters entsetzt und überlegt ernsthaft, ihn anzuzeigen.
Der Krieg macht durch Zufälle aus dem Feigling einen Helden, er bekommt sogar das Eiserne Kreuz Erster Klasse. Prahlend berichtet er darüber in Briefen an ferne Kameraden. Nach dem Kriegsende jedoch sieht die Welt anders aus. Der vorher verachtete Vater wird zum Leitstern. Konrad schämt sich zutiefst für seine Kriegstaten und verschweigt sie hartnäckig – erst recht, als er (gefordert von einem ehemaligen Widerständler) Philosophiedozent wird, Schwerpunkt Ethik.
Konrad gerät in Frankfurt, inzwischen Professor, ins linke Milieu – und mitten in die Wirren der Studentenbewegung. Als die Staatssicherheit der DDR über einen ehemaligen Kriegskameraden an kompromittierende Informationen über ihn gelangt, wird es brenzlig, aber es gelingt dem Sonntagskind Konrad, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Kein Wunder, dass er – Jahre später – die Nachricht vom Fall der Mauer nicht nur mit Freude hört. Erst sein Sohn wird die prahlenden Jugendbriefe seines Vaters finden – und darin einen Menschen, den er nicht kennt und dessen wahre Identität er rekonstruieren will.
Jan Koneffke erzählt von den biografischen Rissen einer Generation, deren Jugend von Propaganda, Krieg, Entnazifizierung und deren Leben in der BRD von ihren Jugenderinnerungen geprägt waren. Ein monumentaler Roman, der deutsche Geschichte vom Weltkrieg bis zur Wende erzählt und zugleich ein großangelegter Versuch ist, die Generation von Günter Grass, Walter Jens, Helmut Schmidt u. a. zu verstehen.
Zum Autor
Jan Koneffke, geboren 1960 in Darmstadt, studierte und arbeitete ab 1981 in Berlin. Nach seinem Villa-Massimo-Stipendium 1995 lebte er für weitere sieben Jahre in Rom und pendelt heute zwischen Wien, Bukarest und dem Karpatenort Măneciu. Jan Koneffke schreibt Romane, Lyrik, Kinderbücher, Essays und übersetzt aus dem Italienischen und Rumänischen.
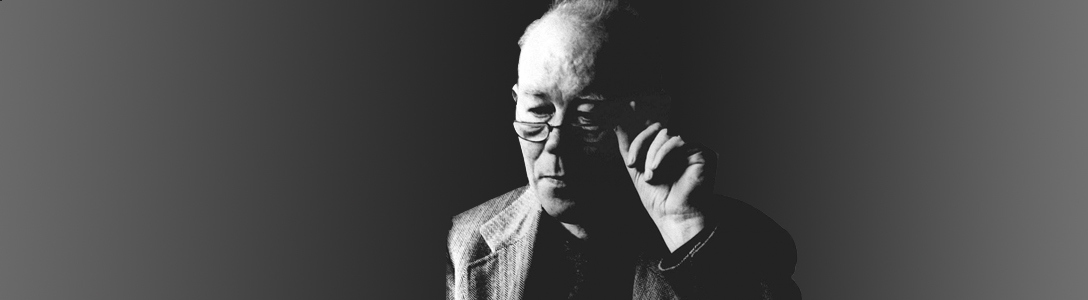


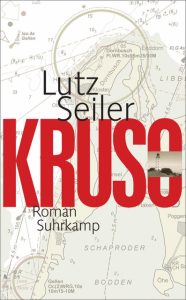 Inselabenteuer und Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft: Kruso, der erste, lang erwartete Roman von Lutz Seiler, schlägt einen Bogen vom Sommer 89 bis in die Gegenwart. Die einzigartige Recherche, die diesem Buch zugrunde liegt, folgt den Spuren jener Menschen, die bei ihrer Flucht über die Ostsee verschollen sind, und führt uns dabei bis nach Kopenhagen, in die Katakomben der dänischen Staatspolizei.
Inselabenteuer und Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft: Kruso, der erste, lang erwartete Roman von Lutz Seiler, schlägt einen Bogen vom Sommer 89 bis in die Gegenwart. Die einzigartige Recherche, die diesem Buch zugrunde liegt, folgt den Spuren jener Menschen, die bei ihrer Flucht über die Ostsee verschollen sind, und führt uns dabei bis nach Kopenhagen, in die Katakomben der dänischen Staatspolizei.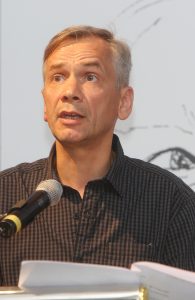 Lutz Seiler wurde 1963 in Gera/Thüringen geboren. Er lebt in Wilhelmshorst bei Berlin und in Stockholm. Nach einer Lehre als Baufacharbeiter arbeitete er als Zimmermann und Maurer. 1990 schloss er ein Studium der Germanistik ab, seit 1997 leitet er das Literaturprogramm im Peter-Huchel-Haus. Er unternahm Reisen nach Zentralasien, Osteuropa und war Writer in Residence in der Villa Aurora in Los Angeles sowie Stipendiat der Villa Massimo in Rom. Für sein Werk erhielt er mehrere Preise, darunter den Ingeborg-Bachmann-Preis, den Bremer Literaturpreis und den Fontane-Preis.
Lutz Seiler wurde 1963 in Gera/Thüringen geboren. Er lebt in Wilhelmshorst bei Berlin und in Stockholm. Nach einer Lehre als Baufacharbeiter arbeitete er als Zimmermann und Maurer. 1990 schloss er ein Studium der Germanistik ab, seit 1997 leitet er das Literaturprogramm im Peter-Huchel-Haus. Er unternahm Reisen nach Zentralasien, Osteuropa und war Writer in Residence in der Villa Aurora in Los Angeles sowie Stipendiat der Villa Massimo in Rom. Für sein Werk erhielt er mehrere Preise, darunter den Ingeborg-Bachmann-Preis, den Bremer Literaturpreis und den Fontane-Preis.
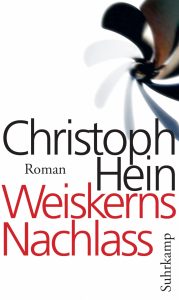 Rüdiger Stolzenburg, 59 Jahre alt, hat seit 15 Jahren eine halbe Stelle als Dozent an einem kulturwissenschaftlichen Institut. Seine Aufstiegschancen tendieren gegen null, mit seinem Gehalt kommt er eher schlecht als recht über die Runden. Er ist ein prototypisches Mitglied des akademischen Prekariats.
Rüdiger Stolzenburg, 59 Jahre alt, hat seit 15 Jahren eine halbe Stelle als Dozent an einem kulturwissenschaftlichen Institut. Seine Aufstiegschancen tendieren gegen null, mit seinem Gehalt kommt er eher schlecht als recht über die Runden. Er ist ein prototypisches Mitglied des akademischen Prekariats. Christoph Hein, geboren 1944 in Heinzendorf/Schlesien. 1967 – 1971 Studium der Philosophie und Logik in Berlin und Leipzig. Bis 1979 Dramaturg und Autor an der Volksbühne Ost-Berlin. Seit 1979 freier Schriftsteller. 1994 Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz. 1998 – 2000 Präsident des P.E.N.-Zentrums Deutschland. 2014 Ehrenpräsidentschaft des P.E.N.-Zentrums Deutschland.
Christoph Hein, geboren 1944 in Heinzendorf/Schlesien. 1967 – 1971 Studium der Philosophie und Logik in Berlin und Leipzig. Bis 1979 Dramaturg und Autor an der Volksbühne Ost-Berlin. Seit 1979 freier Schriftsteller. 1994 Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz. 1998 – 2000 Präsident des P.E.N.-Zentrums Deutschland. 2014 Ehrenpräsidentschaft des P.E.N.-Zentrums Deutschland.
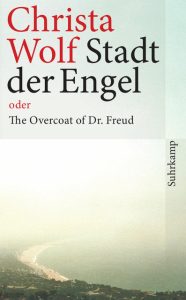 Los Angeles, die Stadt der Engel: Dort verbringt die Erzählerin Anfang der Neunziger einige Monate auf Einladung des Getty Center. Sie spürt dem Schicksal einer gewissen L. nach, die aus dem nationalsozialistischen Deutschland in die USA emigrierte. Ein ums andere Mal wird sie über die Lage im wiedervereinigten Deutschland verhört: Wird der „Virus der Menschenverachtung“ in den neuen, ungewissen deutschen Zuständen wiederbelebt?
Los Angeles, die Stadt der Engel: Dort verbringt die Erzählerin Anfang der Neunziger einige Monate auf Einladung des Getty Center. Sie spürt dem Schicksal einer gewissen L. nach, die aus dem nationalsozialistischen Deutschland in die USA emigrierte. Ein ums andere Mal wird sie über die Lage im wiedervereinigten Deutschland verhört: Wird der „Virus der Menschenverachtung“ in den neuen, ungewissen deutschen Zuständen wiederbelebt?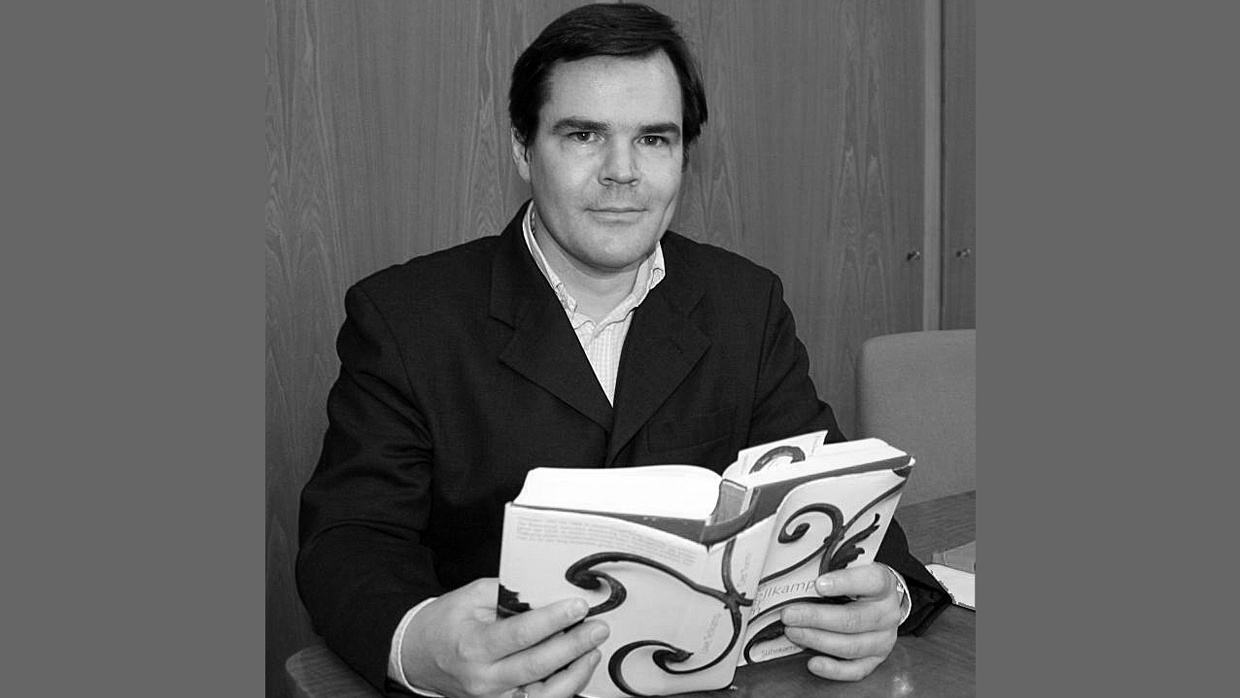
 Ein monumentales Panorama der untergehenden DDR, in der Angehörige dreier Generationen teils gestaltend, teils ohnmächtig auf den Mahlstrom der Revolution von 1989 zutreiben. Kein anderes Buch hat in den letzten Jahren gleichermaßen Kritiker und Publikum derart begeistert.
Ein monumentales Panorama der untergehenden DDR, in der Angehörige dreier Generationen teils gestaltend, teils ohnmächtig auf den Mahlstrom der Revolution von 1989 zutreiben. Kein anderes Buch hat in den letzten Jahren gleichermaßen Kritiker und Publikum derart begeistert. Uwe Tellkamp wurde 1968 in Dresden geboren. In Leipzig, New York und Dresden hat er Medizin studiert, dann an einer unfallchirurgischen Klinik in München gearbeitet. Sein erster Roman „Der Hecht, die Träume und das Portugiesische Café“ (2000) blieb wenig beachtet, die Veröffentlichung des zweiten, „Der Eisvogel“ (2005), erlebte der Autor dann schon als Ingeborg-Bachmann-Preisträger: Mit einem Auszug aus seinem noch nicht vollendeten Romanprojekt „Der Schlaf in den Uhren“ hatte Uwe Tellkamp im Jahr zuvor den renommierten Klagenfurter Wettbewerb gewonnen.
Uwe Tellkamp wurde 1968 in Dresden geboren. In Leipzig, New York und Dresden hat er Medizin studiert, dann an einer unfallchirurgischen Klinik in München gearbeitet. Sein erster Roman „Der Hecht, die Träume und das Portugiesische Café“ (2000) blieb wenig beachtet, die Veröffentlichung des zweiten, „Der Eisvogel“ (2005), erlebte der Autor dann schon als Ingeborg-Bachmann-Preisträger: Mit einem Auszug aus seinem noch nicht vollendeten Romanprojekt „Der Schlaf in den Uhren“ hatte Uwe Tellkamp im Jahr zuvor den renommierten Klagenfurter Wettbewerb gewonnen.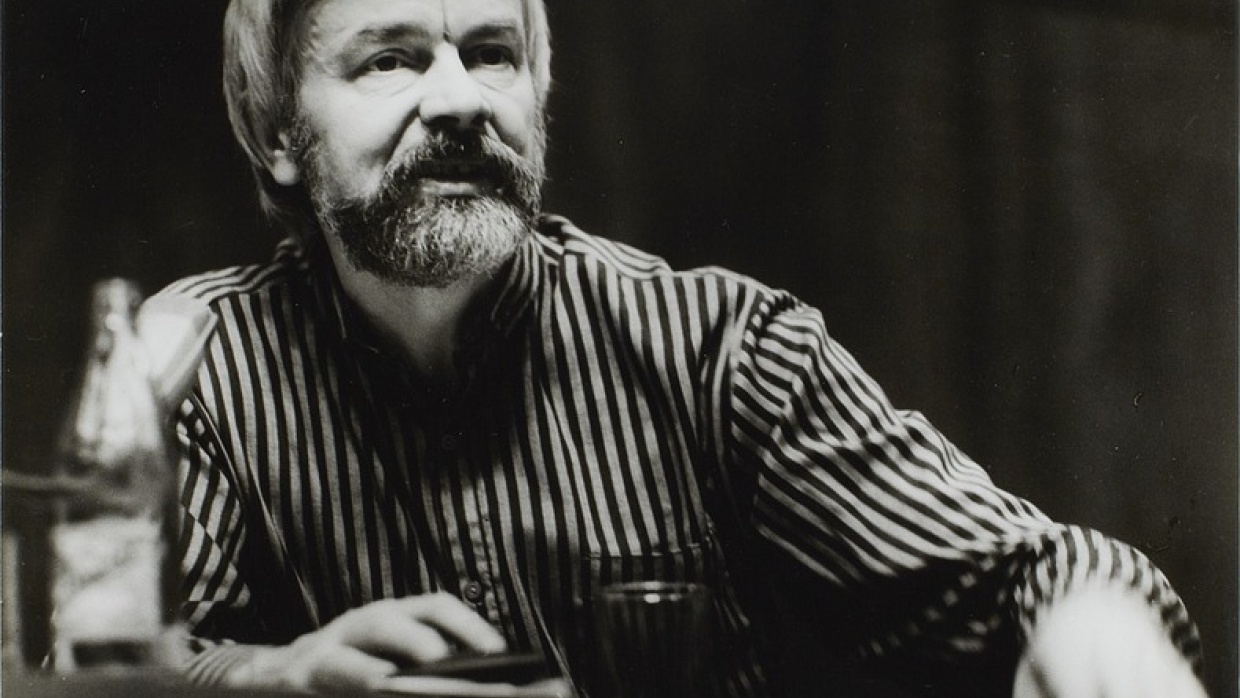
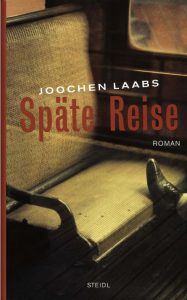 Seinen Aufbruch zu neuen Horizonten hatte sich der junge Mann anders vorgestellt. Etwas mit Geographie wollte er werden und bringt es erst einmal zum Straßenbahnfahrer. Später wird er Ingenieur in Dresden und kommt dienstlich herum in der DDR und dem Ostblock: als Entwickler der „Zahlbox“, eines Kassiersystems für öffentliche Verkehrsmittel. Dann fällt die Grenze, und der zum Zeitzeugen mutierte Ost-Mensch wird eingeladen, an amerikanischen Universitäten vom Alltag und Empfinden der Deutschen hinter der einstigen Mauer zu berichten.
Seinen Aufbruch zu neuen Horizonten hatte sich der junge Mann anders vorgestellt. Etwas mit Geographie wollte er werden und bringt es erst einmal zum Straßenbahnfahrer. Später wird er Ingenieur in Dresden und kommt dienstlich herum in der DDR und dem Ostblock: als Entwickler der „Zahlbox“, eines Kassiersystems für öffentliche Verkehrsmittel. Dann fällt die Grenze, und der zum Zeitzeugen mutierte Ost-Mensch wird eingeladen, an amerikanischen Universitäten vom Alltag und Empfinden der Deutschen hinter der einstigen Mauer zu berichten. Joochen Laabs wurde am 3. Juli 1937 in Dresden geboren. Noch vor der Bombardierung wurde er 1944 zu den Großeltern in die Niederlausitz „verschickt“, verbrachte dort seine Kindheit und machte in Cottbus das Abitur. Nach einer Zeit als Straßenbahnfahrer studierte er von 1956 bis 1961 an der Dresdner Verkehrshochschule und arbeitete bis 1975 als Diplomingenieur an einem verkehrstechnischen Institut. Seine Existenz als freier Autor begann 1976; bis 1978 war er Redakteur der Literaturzeitschrift „Temperamente“.
Joochen Laabs wurde am 3. Juli 1937 in Dresden geboren. Noch vor der Bombardierung wurde er 1944 zu den Großeltern in die Niederlausitz „verschickt“, verbrachte dort seine Kindheit und machte in Cottbus das Abitur. Nach einer Zeit als Straßenbahnfahrer studierte er von 1956 bis 1961 an der Dresdner Verkehrshochschule und arbeitete bis 1975 als Diplomingenieur an einem verkehrstechnischen Institut. Seine Existenz als freier Autor begann 1976; bis 1978 war er Redakteur der Literaturzeitschrift „Temperamente“.
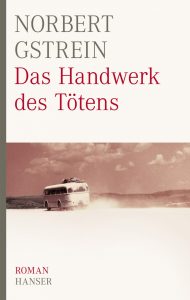 Ein großer Roman über die jüngeren Balkankriege. Erzählt wird die Geschichte des Journalisten Christian Allmayer, der bei einem Hinterhalt im Kosovo ums Leben kommt. Der verhinderte Schriftsteller Paul nimmt das zum Anlass, einen Roman über Leben und Tod des Journalisten zu schreiben. Auf dessen Spuren fährt er durch Kroatien und Bosnien, um sich inmitten der immer noch sichtbaren Verwüstungen ein Bild von der Arbeit eines Kriegsberichterstatters zu machen. Beeindruckend lotet der aus Österreich stammende Schriftsteller Norbert Gstrein das Dilemma derjenigen aus, die das Handwerk des Tötens beschreiben wollen.
Ein großer Roman über die jüngeren Balkankriege. Erzählt wird die Geschichte des Journalisten Christian Allmayer, der bei einem Hinterhalt im Kosovo ums Leben kommt. Der verhinderte Schriftsteller Paul nimmt das zum Anlass, einen Roman über Leben und Tod des Journalisten zu schreiben. Auf dessen Spuren fährt er durch Kroatien und Bosnien, um sich inmitten der immer noch sichtbaren Verwüstungen ein Bild von der Arbeit eines Kriegsberichterstatters zu machen. Beeindruckend lotet der aus Österreich stammende Schriftsteller Norbert Gstrein das Dilemma derjenigen aus, die das Handwerk des Tötens beschreiben wollen.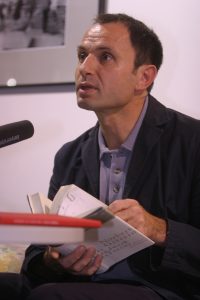

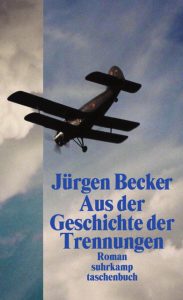 Jürgen Beckers erster Roman wäre nicht entstanden ohne den Fall der Berliner Mauer, ohne die Wiedervereinigung. Seitdem reist Jörn Winter hin und her zwischen Elbe und Oder, Rügen und Thüringer Wald. Magischer Anziehungspunkt ist der märkische Schwieloch-See, wo seine Mutter ums Leben gekommen ist.
Jürgen Beckers erster Roman wäre nicht entstanden ohne den Fall der Berliner Mauer, ohne die Wiedervereinigung. Seitdem reist Jörn Winter hin und her zwischen Elbe und Oder, Rügen und Thüringer Wald. Magischer Anziehungspunkt ist der märkische Schwieloch-See, wo seine Mutter ums Leben gekommen ist. Jürgen Becker wurde 1932 in Köln geboren und verbrachte dort seine Kindheit. Während der Kriegs- und Nachkriegsjahr, zwischen 1939 und 1947, lebte er in Erfurt. Nach Aufenthalten in Osterwiek/Harz und Waldbröl kam er 1950 nach Köln zurück. 1953 Abitur. Nach kurzem abgebrochenem Studium begann er seine Existenz als freier Schriftsteller, seinen Lebensunterhalt bestritt er jahrelang mit wechselnden Tätigkeiten, als Arbeiter und Angestellter, als Werbeassistent und Journalist.
Jürgen Becker wurde 1932 in Köln geboren und verbrachte dort seine Kindheit. Während der Kriegs- und Nachkriegsjahr, zwischen 1939 und 1947, lebte er in Erfurt. Nach Aufenthalten in Osterwiek/Harz und Waldbröl kam er 1950 nach Köln zurück. 1953 Abitur. Nach kurzem abgebrochenem Studium begann er seine Existenz als freier Schriftsteller, seinen Lebensunterhalt bestritt er jahrelang mit wechselnden Tätigkeiten, als Arbeiter und Angestellter, als Werbeassistent und Journalist.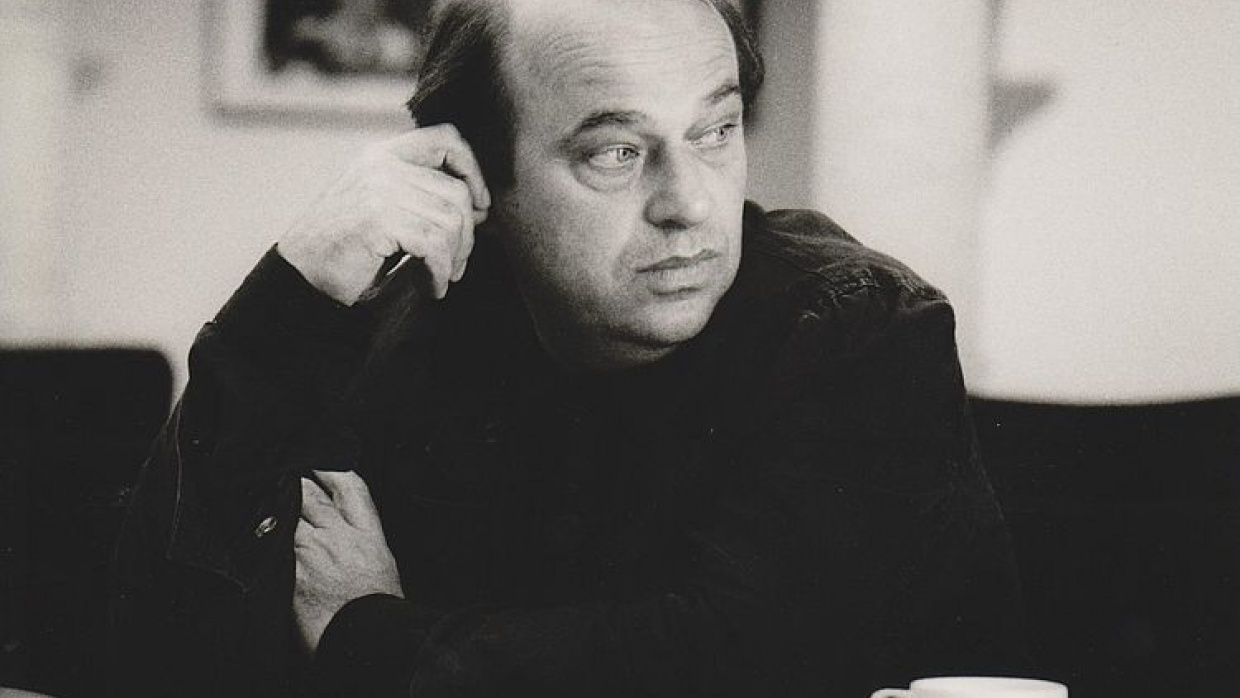
 Für Gert Neumann ist nach dem Ende der DDR die Zeit gekommen, sich vom Eindruck erlittener Demütigungen zu befreien. Dieser radikale Schriftsteller fragt: Wer sind wir eigentlich?
Für Gert Neumann ist nach dem Ende der DDR die Zeit gekommen, sich vom Eindruck erlittener Demütigungen zu befreien. Dieser radikale Schriftsteller fragt: Wer sind wir eigentlich?
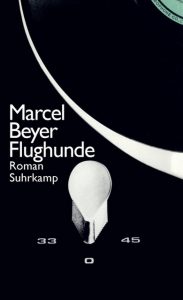 Flughunde sind fledermausähnliche Flattertiere mit hundeartigem Kopf. Für Hermann Karnau sind sie von Kindheit an Sinnbild einer Welt, die vor dem Zugriff fremder Stimmen geschützt ist. Die Stimme ist der Fetisch des Akustikers Karnau, der 1940 den Plan faßt, systematisch das Phänomen der menschlichen Stimme zu erkunden.
Flughunde sind fledermausähnliche Flattertiere mit hundeartigem Kopf. Für Hermann Karnau sind sie von Kindheit an Sinnbild einer Welt, die vor dem Zugriff fremder Stimmen geschützt ist. Die Stimme ist der Fetisch des Akustikers Karnau, der 1940 den Plan faßt, systematisch das Phänomen der menschlichen Stimme zu erkunden. Marcel Beyer wurde am 23. November 1965 in Tailfingen/ Württemberg geboren. Wohnte in Kiel, Neuss und Köln. Nach dem Abitur zwanzig Monate Zivildienst in einem heilpädagogischen Kindergarten. Studium der Germanistik und Anglistik in Siegen. Bevor er 1996 nach Dresden zog, lebte er als Herausgeber („Vergessene Autoren der Moderne“), Übersetzer und Essayist in Köln. 1988-1991 Veröffentlichung von Literaturkritiken. Schreibt seit 1991 Musikkritiken für das Magazin SPEX.
Marcel Beyer wurde am 23. November 1965 in Tailfingen/ Württemberg geboren. Wohnte in Kiel, Neuss und Köln. Nach dem Abitur zwanzig Monate Zivildienst in einem heilpädagogischen Kindergarten. Studium der Germanistik und Anglistik in Siegen. Bevor er 1996 nach Dresden zog, lebte er als Herausgeber („Vergessene Autoren der Moderne“), Übersetzer und Essayist in Köln. 1988-1991 Veröffentlichung von Literaturkritiken. Schreibt seit 1991 Musikkritiken für das Magazin SPEX.